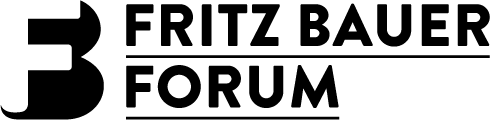01.08.2017
Monika Hauser
Über sexualisierte Gewalt, politische (Erinnerungs-)Kultur und die Verantwortung von Einzelnen
Die Gründerin der Frauenrechtsorganisation medica mondiale und Trägerin des Alternativen Nobelpreises im Gespräch mit der Historikerin Dr. Irmtrud Wojak
„Mir ist es wichtig deutlich zu machen, dass es sich um ein kollektives Problem handelt, und wir nichts ins Individualisieren kommen dürfen.“
MH: Ich bleibe exemplarisch, weil es immer so die Crux mit dem Geschichtenerzählen ist. Einerseits ist es, was die Menschen berührt, und man muss ja irgendwo auch bildlich darstellen, gleichzeitig wehre ich mich dagegen, zuviel zu individualisieren (…). Mir ist es wichtig deutlich zu machen, dass es sich um ein kollektives Problem handelt, das zwar einzelne Frauen erleben, aber wir nichts ins Individualisieren kommen dürfen. Nicht bei der Problematik sexualisierte Gewalt, weil sie so ein großes kollektives Thema ist und Mainstream-Medien das sehr gern auf die individuelle Schiene bringen, sowohl vom Täter her, als auch vom Opfer.
„Die Bestie von Belgien“ hieß es damals bei Dutroux, der drei, vier Frauen vergewaltigt und umgebracht hat. (…) Verantwortliche schieben das gerne ab, Medien, Gesellschaft pointieren gern auf einen Einzelnen, den man die „Bestie“ nennt, um sich selbst davon zu distanzieren: „Mit dem haben wir nichts zu tun!“, „So schrecklich sind wir ja auf keinen Fall!“. Es gibt viele Mythen um das Thema Vergewaltigung, sexualisierte Gewalt, die alle nur dem Zwecke der Distanzierung dienen. „Wir haben damit nichts zu tun, weder von der Opferseite, noch von der Täterseite…“ Deswegen sind diese Individualisierungen oft gefährlich, auch wenn sie nötig sind, um bestimmte Dinge deutlich zu machen. Aber wir sollten immer wieder das Prinzipielle an dieser Gewalt aufzuzeigen.
IW: Das ist interessant, denn gerade im Rahmen der Diskussion über Erinnerung und vor allem Holocaust-Erinnerung meint man ja immer, man soll die Geschichte individualisieren, um den Schülerinnen und Schülern die Geschichte nahe zu bringen.
MH: Das sind vielleicht zwei verschiedene Ebenen. (…) Es ist immer wieder eine Gradwanderung, einzelne Geschichten zu erzählen, aber dahinter diesen kollektiven Charakter der Verbrechen, der Gewalt gegen Frauen, deutlich zu machen. Um eben nicht auf diese individuelle, humanitäre Tränendrüsen-Schiene zu kommen. Dass man aber Menschen und vielleicht insbesondere Kinder und Jugendliche erreichen kann, indem man ihnen ganz bestimmte Geschichten erzählt oder Zeitzeug_innen sprechen, dass glaub’ ich schon, dass das dann eine ganz andere Wirkung hat, als wenn man sich einen theoretischen Vortrag anhören muss oder sich die schrecklichen Filme aus dem Zweiten Weltkrieg anschauen soll. Ich denke, dass Zeitzeugen oder das Lehrpersonal immer wieder klarmachen sollten, das ist ein Mensch, der Euch berichtet, umgebracht worden sind so und so viele Millionen, und so und so viele Juden sind umgebracht worden, und so und so viele Frauen werden vergewaltigt.
Die Crux ist, dass wir eine ganz schlechte Datenlage haben. Wir wissen im Jahr 2017 immer noch ganz wenig zu sexualisierter Gewalt. Und daran erkennt man auch, dass sie keine politische Priorität ist.
IW: Also das würden Sie weiterhin so sagen, nach wie vielen, 25 Jahren, die Sie in diesem Bereich tätig sind? Ich habe darüber nachgelesen in Ihrem Buch und den ersten Studien, die von den USA kamen, die Harvard-Studie usw. Sie würden auch heute noch sagen: sexualisierte Gewalt ist noch nicht als Problem in der Gesellschaft angekommen?
MH: Nicht in dem Maße, dass wir zum Beispiel eine gute Datenlage hätten, dass die Folgen wirklich erforscht sind. Wir sprechen auch vom transgenerationellem Trauma, das ich ein sehr, sehr wichtiges Thema finde, um diese Gewaltspirale nicht immer weitergehen zu lassen, aber es ist noch sehr wenig erforscht. Und wenn Sie sich vorstellen, dass in Deutschland die letzte deutschlandweite Studie zum Vorkommen sexualisierter Gewalt aus dem Jahre 2004 ist, dann spricht das für sich. Europaweit stammt die erste Untersuchung zu diesem Thema aus dem Jahre 2014. Es ist immer die Frage: Wie wird gefragt, welche Themen, welcher Fokus ist der jeweils spezifische. Wenn ich von einer umfassenden, breiten Datenlage spreche, dann stehen wir erst am Anfang.
„In unseren angeblich hochentwickelten Industrieländern ist es für Frauen nicht einfach, darüber zu sprechen.“
IW: Frau Hauser, ich würde jetzt gerne mit Ihrer Geschichte anfangen. Und zwar, wie Sie eigentlich auf das Thema gekommen sind und vielleicht mit der eher persönlichen Frage, wenn Sie die erlauben: Was waren oder wer waren eigentlich ihre Held_innen der Kindheit für Mut, und Widerstand und was hat Sie unterstützt, sich so zu engagieren? Was oder auch wer? Gab es da irgendwelche Helden?
MH: Also „Helden“ gab es schon mal gar keine. Wenn, dann gab es die ein oder andere „Heldin“. Ich habe interessanterweise sehr früh Simone de Beauvoir gelesen, auch weil wir im Französischunterricht von Sartre und Beauvoir Texte gelesen haben, in der Schweiz hat man ja schon relativ früh Französischunterricht, das hat mich sehr fasziniert. Auch ihre Geschichte, dass sie gegen viele Widerstände weitergeschrieben hat. Und dann diese Verbindung zwischen theoretischem Denken und praktischer Ausprägung in ihren Romanen, das hat mir sehr gut gefallen. Ansonsten hab ich nicht allzu viele Frauen und Männer gesehen, zumindest nicht in meiner Umgebung, die zu guten Helden oder Heldinnen getaugt hätten.
IW: War das dann der eigentliche Auslöser?
MH: Der Auslöser war, dass ich einfach früh schon von sexualisierter Gewalt erfahren habe. Ich bin in der Ost-Schweiz aufgewachsen, meine Eltern waren Arbeitsmigranten, die in den fünfziger Jahren aus Südtirol weggegangen sind, weil es nach dem Krieg in Südtirol einfach keine Arbeit gab und große Armut herrschte. Sie haben dann in der Schweiz Jobs gefunden und meine Schwester und ich sind dort aufgewachsen. Wir sind aber mindestens fünf, sechsmal im Jahr nach Südtirol gefahren, weil meine Eltern unter sehr großem Heimweh litten, und deswegen jedes lange Wochenende, Pfingsten, Sommerferien sowieso, im Dorf meiner Eltern waren, wo auch die ganze Verwandtschaft lebte.
Meine Großmutter mütterlicherseits hat mich früh schon ausgesucht als eine, der sie Dinge erzählen kann. Warum das so war, steht in den Sternen. Auf jeden Fall, hatte sie das Gefühl, dass sie sich mir anvertrauen kann. Da war ich elf, zwölf Jahre alt, das war eigentlich viel zu früh, um jemanden schon von den eigenen Gewalterfahrungen zu berichten. Ich weiß noch gut, wie sie mit mir zu einem bestimmten Weiler spaziert ist, wo es Kaffee gab, und ich dann ein tolles Getränk, einen Softdrink bekam, was es sonst nie gab, und sie ihren Kaffee getrunken hat und unterwegs hat sie mir immer erzählt. Vielleicht hat sie mich ausgesucht, weil ich immer wieder zurück in die Schweiz gefahren bin, also nicht ständig in ihrer Umgebung war und sie das Gefühl hatte, sie kann es da besser abladen.
Auf jeden Fall hab’ ich sehr früh Sensoren für dieses Thema ausgebildet und in der Folge immer Geschichten von Frauen gehört. Ich war dann mit siebzehn in so einem Freiwilligeneinsatz in einem Kibbuz in Israel und dort haben mir zwei Ausschwitz-Überlebende, Frauen, von ihren Gewalterfahrungen berichtet. Während meine ganzen Kolleginnen und Kollegen am Pool saßen, bin ich jeden Tag zu ihnen hin und habe mir ihre Geschichten angehört. Auch wieder interessant, warum sie mich ausgesucht haben, weil mir später der Leiter des Kibbuz erzählt hat, dass sie eigentlich mit niemandem mehr deutsch reden möchten. Ich war aus der Schweiz, Italienerin, anscheinend eine Mischung, die weit genug weg vom Deutschen war.
So ging das eigentlich weiter bis heute. Kürzlich, bei einer hochrangingen UN-Konferenz, kam eine UN-Frau zu mir her und sagte: „Ich hab’ darüber noch nie mit jemanden geredet, was ich ihnen jetzt erzählen möchte“, und hat mir eben auch von ihrer Gewalterfahrung berichtet. Das heißt, es gibt anscheinend auch keine Orte, wo geredet werden kann, wenig vertrauensvolle Räume, wo Frauen sich genügend geschützt fühlen, über das zu sprechen.
Frauen, die Kariere machen – ob jetzt bei der UN, bei Ministerien oder in der Wirtschaft, sei dahingestellt – scheinen es auch schwer zu haben, über das, was ihnen geschehen ist, sprechen zu können, zumal wenn es das Thema sexualisierte Gewalt betrifft. Und das zeigt, es ist eben etwas anderes, ob ich davon berichte, dass ich überfallen worden bin und mir mein Geld geklaut wurde oder mein Auto aufgebrochen wurde, oder ich einen schweren Unfall hatte, es ist etwas ganz anderes, was sexualisierte Gewalt für Auswirkungen auf einen Menschen hat. Ich sage bewusst „auf einen Menschen“, weil wir wissen, dass auch Männer und Jungs vergewaltigt werden, was ein noch tabuisierteres Thema in allen Gesellschaften ist. Dieses Schweigegebot gehört bei Leibe nicht der Vergangenheit an. Ob ich von hochpatriarchalen Nachkriegsgebieten spreche, da ist es ein existenzielles Schweigegebot, Frauen wissen genau, wenn sie darüber sprechen, könnten sie umgebracht werden. Aber auch in unseren angeblich so hoch entwickelten Industrieländern ist es nicht einfach für eine Frau, darüber zu reden.
IW: Dann war es, ich komm nochmal zurück auf die Kindheit und Jugendgeschichte, eigentlich nicht die Erfahrung als die Migrantin, die in der Schweiz lebt, vielleicht ausgegrenzt ist und Unrecht erlebt, sondern eher das eigene Wahrnehmen. Es ist ja oft so, wenn man früh als Kind oder Jugendlicher Unrecht erlebt, dass man dann sensibel für die Verletzung von Menschenrechten oder Menschenwürde ist. Bei Ihnen war es eher das Erleben, das ihnen mitgeteilt wurde?
„Berichte zu sexualisierter Bewalt, die Kriegserfahrungen meiner Mutter, die Diskriminierung als „südtiroler Mädchen“, das hat mich widerständig gemacht.“
MH: Also ich sehe schon drei Linien, die Linie der Berichte zu sexualisierter Gewalt, worüber ich gerade gesprochen habe, dann sehe ich die Linie der Kriegserfahrungen, meiner Mutter in erster Linie, und ich sehe die Diskriminierung, mich als südtiroler Mädchen in der Schweiz. Das kam letztendlich alles zusammen und hat mich sehr früh sehr widerständig gemacht. Diese Dinge kamen zusammen, unbewusst natürlich.
Die Südtiroler mussten sich ja während des Zweiten Weltkriegs, Anfang der vierziger Jahre, in der sogenannten Optionszeit entscheiden, ob sie im faschistischen Italien bleiben oder ins faschistische Nazi-Deutschland gehen. Da gab es dann die „Geher“ und die „Dableiber“. Das ist auch interessant, nach ’45, als die „Gegangenen“ wieder zurückgekommen sind, welche Konflikte sich da aufgetan haben, die zum Teil bis heute nicht wirklich kollektiv in einer positiven Erinnerungsarbeit in Südtirol behandelt wurden. Ich erlebe das immer wieder in Nachkriegsgebieten, dass jene, die fliehen konnten, die Asyl draußen bekamen, und dann wieder zurückgehen, welche offenen Wunden das letztendlich für die sind, die dableiben mussten. Der Großvater mütterlicherseits hat sich zum Gehen entschieden. Sie sind dann nach Niederbayern gekommen und da ist mein Großvater natürlich sofort als Soldat eingezogen worden und meine Oma saß da, mit den vier Kindern, und hat letztendlich die ganze Kriegszeit mitgemacht. Meine Mutter hat mir oft in meiner Kindheit davon erzählt, wie sie mit dem kleinen Bruder auf einer Wiese Gänse gehütet hat und dann die amerikanischen Tiefflieger gekommen sind und ihre Ladung fallen gelassen haben. Die Großmutter wusste dann oft nicht, ob ihre Kinder noch leben. Ich kann mich auch an einen Bericht erinnern, wo sie schon in den Schutzkeller, bei dem Angriff, runterging, die Großmutter, mit den anderen Kindern, und meine Mutter und ihr kleiner Bruder sich auf dem Heimweg versteckt haben und natürlich erst nach dem Angriff in die Wohnung zurückgekommen sind, und wie schrecklich das für alle war, weil man nicht wusste ob die anderen jeweils noch leben.
Das ist etwas, das ich auch immer wieder vor Ort sehe, welche tiefen seelischen Wunden diese Angst um die anderen schlägt. Das sind Traumatisierungen, die passen nicht unbedingt in irgendwelche medizinischen Bücher rein, in Kodierungen, gesetzliche Regelungen, wann so eine Traumatisierung sozusagen „verheilt“ sein soll. Das sind wirklich lebenslange Prozesse und hier haben die Fachwelt und vor allem Gesetzgeber viel zu lernen, dass es eben keine Null-Acht-Fünfzehn Kodierung gibt, sondern dass das natürlich individuell damit zusammenhängt, wie ein Mensch das bearbeiten kann, was er oder sie erlebt haben. Gerade für Kinder kann die tiefe Angst, nicht mehr nach Hause kommen zu können oder die Mutter lebt vielleicht nicht mehr, lebenslange Narben hinterlassen.
Das waren die Geschichten, die meine Mutter uns erzählt hat. Das waberte so als „Traumamaterial“ herum und heute würde ich schon sagen, dass ich transgenerational was mitbekommen habe, wo ich gar nicht wusste, wie ich damit umgehen soll, wie ich das einsortieren kann. Ich habe dann mit elf, zwölf begonnen, mir die ganzen schrecklichen Bildbände vom Ersten und vom Zweiten Weltkrieg zu organisieren. Ich war in die Bibliotheken in der Stadt St. Gallen eingeschrieben, kirchliche Bibliotheken, Stadtbibliothek, in der Schule. Da gibt es Bildbände von verwundeten Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg, die einfach nur scheußlich sind. Und anscheinend hat niemand gestört, dass ich mir die kiloweise mit nach Hause hole. Heute denke ich, dass ich mich dem Schrecken nähern wollte. Ich hab’ so viel gehört von meiner Mutter und nur unbefriedigende Antworten von meiner Mutter und meinem Vater bekommen, wenn ich tiefergehend nachgehört habe. In der Schule ist das auch nicht behandelt worden, zumal in der Schweiz auch noch ein anderes Klima herrschte. Ich habe mich dann sehr intensiv mit Literatur und Büchern beschäftigt. Irgendwann hab’ ich aufgehört und diese Dinge zur Seite gelegt, aber sie haben schon einen tiefen Eindruck hinterlassen und mir eine Ahnung davon gegeben, wie zerstörerisch das alles ist. Wenn mir meine Mutter heute, dachte ich als Mädchen, noch so davon erzählt und dabei noch so aufgewühlt und aufgeregt erscheint, und das so viele Jahre her ist, mindestens zwanzig, dann muss das schon was Elementares an menschlicher Erfahrung sein. Das wusste ich früh. Deswegen hab’ ich mich von früh an für diese Themen interessiert.
Ja, und die Diskriminierung in der Schweiz, wir waren eigentlich die richtigen Ausländer, sprich weiß, haben deutsch gesprochen, mein Vater war damals, habe ich gefunden, überassimiliert. Ich war sehr ungerecht über das politische Verhalten meiner Eltern, weil ich schon früh das Buch Die Schweiz wäscht weißer von Jean Ziegler gelesen hab, das war für mich eine Erlösung, so ein Buch zu lesen, wo ein kluger Mann die Dinge schreibt, von denen ich so ahnte, dass doch in der Schweiz Vieles nicht stimmt. Dass Vieles Propaganda ist, mit Propaganda meine ich die tolle Landschaft, der super Erholungswert, die ganzen Dinge, mit denen die Schweiz viel Geld gemacht hat, von der Schokolade angefangen, dass das nicht alles ist. Ich fühlte ja, dass da was nicht stimmt. Daher waren dann solche Menschen und solche Bücher schon eine Erlösung für mich, zu wissen, ich bin nicht verrückt. Das stimmt schon, dass ich da eine komische Ahnung hatte, auch wenn ich die Dinge damals noch nicht hätte beim Namen nennen können. Ich hatte so etwas wie ein Doppelleben, das eine war das Mädchen in der Schweiz, das fleißig in die Schule geht, für ihre Eltern supergute Noten macht, für den Vater, der seine Lebensträume nie hat realisieren können, aufgrund seiner Armut, und nun in der Schweiz fleißig seinen Job macht, damit er sich ein Haus in Südtirol hinstellen kann. Das war so der typische Migrantentraum von ihm, aber beruflich hat er nie das machen können, was er sich gewünscht hat. Für ihn hab’ ich sicher auch Medizin studiert. Auf jeden Fall war ich immer eine fleißige Schülerin, bis ich immer aufsässiger wurde und mich meine Eltern auch nicht mehr verstanden haben, was sich da bei mir abspielt. Und diese Schweiz… Ich fand es immer schwieriger als junger Mensch dort zu leben.
IW: Sie haben in der Schweiz studiert?
MH: Nein, ich habe in Innsbruck studiert, was noch ein anders Pflaster an Doppelmoral war. Zu der Zeit war der Chefredakteur der Tiroler Tageszeitung noch ein Ex-Nazi, das war allgemein bekannt. Da war noch so viel präsent, was nicht aufgearbeitet war, worüber man nicht reden durfte. Ich hatte dann zwei nigerianische Studienkollegen und bin mit denen auch immer wieder mal in Innsbruck unterwegs gewesen und wir haben wirklich erlebt, dass einmal, wir gehen die Straße entlang, ein Busfahrer, mit einem leeren Bus, der wahrscheinlich zum Depot fahren wollte, auf uns zuhält und erst im letzten Moment reiße ich den Freund zur Seite und wir springen weg. Ich weiß nicht, was sich der Busfahrer dabei gedacht hat, der hätte ja ziemliche Schwierigkeiten bekommen, wenn da was passiert wäre.
IW: Der Weg aus der Schweiz führte über Österreich?
MH: Das war freiwillig gewählt, weil Südtirol und Tirol kulturelle Abkommen haben, dass eben da studiert werden kann. Für mich war dann nach Essen zu kommen, nach Nordrhein-Westfalen, auch eine gewisse Erlösung. Da waren die Frauen direkt, das war meine erste Stelle als Assistenzärztin, das liebte ich doch sehr. Den Slang und die direkte Art der Frauen dort.
IW: Ich komme aus Bochum.
MH: Ok. Dann wissen Sie ja wovon ich rede.
IW: Ja.
MH: Dass der Bürgersteig um achtzehn Uhr hochgezogen wurde, Essen eine scheußliche Stadt war usw., sei mal dahingestellt. Aber die ersten Jahre als Assistenzärztin hat man eh keine Zeit für nichts, weil man nur Schichten und Nachtdienste macht, viel arbeiten muss, daher hab’ ich nicht so viel mitgekriegt.
IW: Sie haben in Ihrem Buch auch geschrieben, dass es schwierig war, die Stelle zu bekommen.
MH: Die Stelle zu bekommen, überhaupt war es damals eine andere Zeit, wo Gynäkologie-Assistenzärztinnen-Stellen sehr begehrt waren.
IW: Also das hatte keine politischen Hintergründe durch Ihr politisches Engagement für die Frauen, oder?
MH: Nein, nein das war ja damals noch nicht bekannt. „medica mondiale“ kam ja erst sehr viel später.
IW: Okay, es hatte damit also nichts zu tun.
MH: Nein. Ich weiß nicht, ich glaube, ich hab’ damals um die 200 Bewerbungen geschrieben und 199 Absagen gekriegt. Aber die eine war es dann.
IW: Und waren Sie dann mehrere Jahre im Ruhrpott?
„Alle Stellen, die ich hatte, waren immer gute Orte, um zu begreifen, was sich auch in der Gynäkologie an Frauenfeindlichkeit abspielt.“
MH: Ich habe dann drei Jahre diese Assistenzärztinnen Stelle gehabt, bis ich mich entschieden habe, nach Bosnien zu gehen. Ich habe den ersten Teil der Facharztausbildung in Essen gemacht. Alle Stellen, die ich hatte, waren immer gute Orte, um viel zu lernen und viel zu begreifen, was sich auch in der Gynäkologie an Frauenfeindlichkeit abspielt. Die erste Stelle hatte ich in Südtirol in einem Regionalkrankenhaus unweit dem Dorf meiner Eltern, wo ich „Praktisches Jahr“ gemacht habe. Dort regierte noch ein Chefarzt mit wirklich feudalem Gebaren. Da hatten wir doch etliche Auseinandersetzungen, und er fand es unmöglich, dass ich als eine 25-jährige, junge angehende Ärztin mich erdreistete, ihm Widerworte zu geben. Das hatte er noch nie erlebt. Und auch zu kritisieren, wie mit den Frauen umgegangen wird. Ich habe dort zum Beispiel erlebt, wie eine Bergbäuerin mit starken Unterbauchschmerzen zu uns kam und relativ schnell haben wir dann ein Eierstockkarzinom diagnostiziert, haben Ihrem Mann deutlich gemacht, dass sie jetzt sofort operiert werden muss, und er sagte: „Nach der Ernte!“ Das heißt, es sind Monate darüber vergangen, und dann konnte man sie eigentlich nur noch palliativ versorgen. Sie ist dann auch in dem Frühling danach gestorben.
Da wurde mir immer klarer, auf wie vielen Ebenen Frauen Gewalt erleben. Ich habe auch da Geschichten von Frauen gehört, von sexualisierter Gewalt, und habe verstanden, dass der Chefarzt, der Oberarzt, die anderen Kollegen, nichts davon hören wollen. Mich auch ausgegrenzt haben, wenn ich darüber sprechen wollte. Das ist eine Erfahrung, die ich fortlaufend gemacht habe, sowohl bei meiner Facharztausbildung in der Uni-Klinik in Essen, als auch später im Klinikum Holweide in Köln: Dass man eigentlich von dem Thema nichts hören wollte und von mir als Botschafterin auch nichts wissen wollte. Die Themen sind einerseits zu schmerzhaft, um sich damit zu beschäftigen, und andererseits will man alles weit von sich halten, denn wenn man es wüsste, müsste man Verantwortung übernehmen und etwas verändern.
IW: Etwas tun, genau. Zu schmerzhaft, weil sie zu schambesetzt sind, oder, ich meine, es ist ein strukturelles Problem, das damit verbunden ist, und sehr grundlegender Veränderungen bedürfte. Da ist einmal die persönliche Scham, die für die Betroffenen damit verbunden ist, die selber ja auch nicht sprechen, und auf der anderen Seite das strukturelle Problem, oder?
„Wir sprechen immer von dieser Scham, aber vielleicht ist die Gesellschaft Schuld daran, dass die Frauen sich so beschämt fühlen sollen.“
MH: Zuerst ist das gesellschaftliche Problem da. Wenn Frauen mitkriegen, dass sie darüber schweigen sollen, und das schon als Mädchen, dann wissen sie, wenn mir das passiert, dann muss ich es für mich behalten. Zum Beispiel bosnische Frauen, die als Zeuginnen beim Kriegsverbrechertribunal in Den Haag fungieren sollten, mit denen haben wir gesprochen, sowohl direkt in der Kriegs- oder Nachkriegszeit, als auch sehr viel später, als wir eine Studie dazu gemacht haben, wie es den Frauen vor Gericht ergeht. Es war sehr klar, dass sie eigentlich alle sprechen möchten. Von Scham haben wir da gar nicht so viel gemerkt. Ich meine, natürlich gibt es dieses psychologische Problem der Scham über eine Gewalterfahrung, zumal eine, die so sehr das Intimste betrifft, darüber nicht einfach sprechen zu können, wenn das „Setting“ nicht entsprechend gegeben ist. Aber diese Frauen, viele Jahre nach dem Krieg, waren sehr bereit zu sprechen, so wie es Bosnierinnen ab ´93 schon waren, damit die Welt erfährt, was ihnen geschieht.
Sie haben aber von Ihrem direkten Umfeld, ihrer Familie, von der weiteren Gesellschaft, zu hören bekommen, dass sie darüber schweigen sollen. Sie selbst wären sehr bereit gewesen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir uns noch viel genauer anschauen müssen. Wir sprechen immer von dieser Scham, aber vielleicht ist die Gesellschaft schuld daran, dass die Frauen sich so beschämt fühlen sollen, dass sie darüber nicht sprechen kann. Wenn wir ein anders Klima schaffen können, und es aus diesem ganzen Individualisierten herausnehmen, weil wir wissen, dass jede dritte bis vierte Frau in einem europäischen Land im Laufe ihres Lebens eine sexualisierte Gewalterfahrung gemacht hat, umso höher ist die Zahl natürlich in einem Kriegsgebiet.
Wenn wir wissen, dass so viele Frauen das erlebt haben, dann können wir in einem Raum abzählen, wir können aber auch die Männer abzählen, die wohl auch Täter sind. Und alle haben ein Interesse daran, sich vom Thema zu distanzieren. Die Rechnung zahlen aber letztendlich allein die Überlebenden, die das wieder in sich vergraben müssen, anstatt es rauslassen zu können. Denn durchs Rauslassen, das wissen wir, kann eine Bearbeitung erst beginnen. Zu welchem Zeitpunkt, soll die Frau selbst bestimmen. Aber ich würde ein Stück weit drängen. Es gibt einen psychologischen Prozess in der Frau, und es gibt den gesellschaftlichen Prozess, wie ihr begegnet wird. Idealerweise kommt beides zusammen. Nämlich, dass überhaupt erst nicht aufkommt, dass sie vielleicht schuld dran ist. Dass der Rock zu kurz war, warum geht sie abends noch raus… und, und, und. Diese Mythen bestehen leider nach wie vor. Würde das überhaupt nicht der Fall sein, sondern würde die sie umgebende Gesellschaft mit offenem Ohr und offenem Herzen und einer hohen Empathie auf die Frau zugehen und sagen: „Das ist schrecklich was du erlebt hast, wir unterstützen dich darin, das gut zu verarbeiten und du bist die gleiche wie vorher, du bist meine Tochter, meine Frau, du bist meine Schwester…“, dann wäre das ganz anders bearbeitbar. Insofern hängen der psychologische Bearbeitungsprozess und das gesellschaftliche Verhalten zusammen.
IW: Ich hab’ mich intensiv mit dem sogenannten „Überlebenden-Syndrom“, wie das immer genannt wird, beschäftigt. Angeblich aus Scham- und Schuldgefühlen die eigene Geschichte nicht erzählen zu wollen, auch der angebliche Schuldkomplex, überlebt zu haben. Meines Erachtens ist es so, dass unsere Gesellschaft den Überlebenden im Nachhinein nahegelegt hat: „Fühlt ihr euch schuldig.“ Denn das, was sie (die Überlebenden) als Schuld und Scham empfinden, kann eigentlich nur sein, dass ihnen das angetan worden ist, sie haben ja nicht die „Schuld“. Sie brauchen sich auch gar nicht zu schämen, es gibt keinen Grund, sich dafür zu schämen. Es ist schämen für die anderen, die das getan haben, die verletzte Menschenwürde. Was Sie sagen, ist sehr ähnlich, dass man eigentlich das, was einen selbst betrifft, auf die anderen projiziert und denen die Schuld zuschiebt, oder?
MH: Diese beiden Ausschwitz-Überlebenden im Kibbuz damals, ich war sehr erstaunt, als sie mir sagten: „Niemand will unsere Geschichte hören, hier im Kibbuz.“ Und das Kibbuz ist ja entstanden, die Kausalität ist ja sehr klar: „Niemand will unsere Geschichte hören. Wenn mal wieder ein Journalist aus den USA kommt, dann holt man uns, dass wir von Ausschwitz berichten. Aber um uns herum wird es tabuisiert“. Wir sprechen von einem Kibbuz in Israel. Und das habe ich später in Arbeitszusammenhängen mit israelischen Fachleuten immer wieder gehört, dass es tabuisiert wird. Also entweder es wird überhöht, hier unsere beiden Ausschwitz-Überlebenden, oder es wird tabuisiert, man will nichts mehr davon hören. Und ich sag nochmal, weil es entweder zu schmerzhaft ist, oder weil man es weit weg halten will, wie Sie gerade gesagt haben. Es wird delegiert auf einzelne, aber es werden nicht die gesellschaftlichen Strukturen angeschaut, die damit zu tun haben, die so etwas überhaupt ermöglichen. Und das ist bei sexualisierter Gewalt ein ganz wesentlicher Punkt, das sich erst grundlegend etwas verändern würde, wenn unsere Gesellschaft eine andere Offenheit zu diesem Thema hätte, und nicht das Thema zu geeigneten Zwecken instrumentalisieren würde. Die Medien zum Beispiel. Was ist über den Kachelmann-Prozess berichtet worden! Und gab es da irgendeine Gerechtigkeit für die Frau?! Im Gegenteil!
Psychosoziale Wege der Trauma-Bearbeitung sind in Verruf, in Diskreditierung gekommen. Die Medien schaffen es durch eine gewisse Sensationslüsternheit, dieses Thema auf eine völlig falsche Ebene zu bringen, wo Frauen dann noch mehr schweigen und sich erst recht isoliert und alleine fühlen, und durch die Art, wie die Medien damit umgehen, re-traumatisiert werden. Aber die breite Bevölkerung sich zurücklehnen und sagen kann: „Damit hab’ ich ja nun wirklich nichts zu tun!“ Wir sehen immer in geeigneten politischen Momenten, dass die vergewaltigten Frauen für politische Zwecke instrumentalisiert werden. Und das kann nur gehen, wenn es keine breite gesellschaftliche, normative Übereinstimmung gibt, sexualisierte Gewalt zu verdammen. Für ein Sachdelikt, wenn man ein Auto zerkratzt hat, kann man sicherer sein, dass man in Deutschland Gerechtigkeit bekommt, als wenn eine Frau sexualisierte Gewalt erlebt.
IW: Während auf der anderen Seite ja die Frauen oder die Überlebenden von solcher Gewalt selbst erzählen wollen. Es ist ja gar nicht so, dass sie das in sich verschließen wollen und nicht aussagen wollen.
„Die Medien wollen die brisantesten Geschichten hören, man möchte sehen, wie die Frau in Tränen ausbricht.“
MH: Das ist ein Gerücht, dass Frauen nicht reden wollen, aber natürlich, wenn sie gesellschaftliche Reaktionen erleben, dann schweigen sie. Das ist das Problem. Ich habe das miterlebt, immer wieder, Bosnien, Kosovo, Afghanistan, jedes Mal wieder waren die Medien da und wollten die brisantesten Geschichten hören. Wie sie denn die IS-Gewalt überlebt haben, die Geschichten sollen berichtet werden. Möglichst mit Gesicht, man möchte sehen, wie die Frau dann in Tränen ausbricht, man möchte sehen, dass das Opfer wirklich ein richtiges Opfer ist. Wenn sie bei den Anhörungen in eine Distanzierung gehen, was sie vielleicht lange mit ihrer Therapeutin erarbeitet haben, wenn sie also wie kalt wirken, dann kann die Gutachterin schreiben: „Wirkt kalt, nicht glaubwürdig!“ Also das Problem bleibt immer bei den Frauen, immer bei den Überlebenden.
IW: Immer bei den Opfern…
MH: Immer bei den Opfern…
IW: Die aber in der Situation eigentlich schon so viel Kraft und Stärke aufgebracht haben. Also ich tue mich schwer mit dem Begriff ‚Opfer’, der, finde ich, immer leichtfertig angewandt wird. Das ist ja auch eine Form der Stigmatisierung, wenn man von den Frauen immer nur von den „Opfern“ spricht!
MH: Wir sprechen überhaupt nicht von den Opfern. Es mag mal, wenn ich über einem Prozess rede, der richtige Terminus sein. Aber wir sprechen eigentlich nur von Überlebenden, um damit die Ressourcen der Frauen deutlicher zu machen. Das ist eine ganz andere Haltung, wenn ich von Überlebenden spreche. Ich gestehe ihr zu, dass sie ihre eigene Ressourcengeschichte hat, und habe nicht wie 1993, als über die bosnischen Frauen berichtet wurde, diesen Schlüssellochblick auf das Vergewaltigungsgeschehen. Man hat eigentlich nur den Blick auf ihren verletzten Intimbereich gehabt. Sag ich jetzt mal etwas provokativ.
Dass diese Frauen Mütter, Familienmanagerinnen, Professorinnen, Richterinnen, Hausfrauen, Schülerinnen, Studentinnen waren, im Leben vorher und im Leben danach – das Leben danach war natürlich ein völlig anderes –, dieser ganzheitliche Blick auf die Person hat gefehlt. Man wollte nur dieses Eine sehen, gleichzeitig will man aber nicht flächendeckend wissen, wie viele Frauen diese Gewalt erleben. Es könnte meine Schwester sein, meine Freundin, meine Tante. Was ist hier eigentlich los? In welcher Gesellschaft leben wir, dass es für Männer anscheinend so einfach ist, Gewalt auszuüben? Was ist mit unserer Gesellschaft los, dass wir das Stigma der Überlebenden geben und sagen: „Du bist schuld, du hast dich so und so verhalten!“ Anstatt auf die Täter zu schauen, Gesetze zu machen, dass es gute Settings gibt, wo Frauen aussagen können. Die Straflosigkeit sexualisierter Gewalt ist wirklich ein großes Armutszeugnis für unsere Gesellschaft. Die Anzahl der Männer, die für Vergewaltigungsdelikte in Deutschland verurteilt werden, ist weit unter zehn Prozent (…). Und alleine die Anzeige zu stellen, ist in Deutschland nicht einfach. In dieser EU-weiten Studie, was meinen Sie, welches Land hat die höchste Gewaltzahl in Europa? Das ist eine rhetorische Frage, manchmal kann man die Rassismen bei den Leuten überprüfen, wenn man das fragt.
IW: Ich weiß es nicht.
MH: Männer sagen dann sehr oft: „Italien, Spanien“. Es ist Dänemark.
IW: Dänemark?
MH: Dänemark! Und zwar nicht, weil die dänischen Männer mehr vergewaltigen würden, als die deutschen oder die italienischen oder die ukrainischen Männer, sondern weil die gesellschaftliche Atmosphäre und die Reife der Institutionen in Dänemark zu dem Thema die Höchste ist. Das heißt: die Polizei ist trainiert, wenn Frauen kommen, um zu berichten. Und weil die Frauen wissen, dass sie dort eine Polizistin antreffen, die über Re-traumatisierung Bescheid weiß, die Bescheid weiß, was für ein Setting sie gestalten muss, gehen auch mehr Frauen zur Polizei, oder in Beratungsstellen. Und trotzdem haben wir so eine hohe Gewaltzahl dort. Das ist doch sehr aussagekräftig über unsere sehr gewalttätigen Gesellschaften.
IW: Gibt’s da auch eine Erklärung dafür? Dass es gerade Dänemark ist?
MH: Ja, was ich gerade gesagt habe, die Erklärung dafür ist, dass dort die Polizei am weitesten, am sensibilisiertesten ist, in der Ukraine zum Beispiel sind die Zahlen minimal. Aber in der Ukraine, wenn man da auf die Polizeistation geht, muss man eventuell befürchten, dort erneut vergewaltigt zu werden. Oder auf jeden Fall höchst diskriminiert zu werden, wie einer Frau denn einfalle, hierher zu kommen und zu sagen, sie wäre von ihrem Mann vergewaltigt worden. Das ist ein Widerspruch in sich. Für immer noch viele Leute. Das heißt, wenn überhaupt nicht angezeigt wird, dann heißt das nicht, dass in dem Land keine Gewalt geschieht, sondern, dass dort keine gesellschaftliche Arbeit geleistet wurde, dass die entsprechenden Institutionen mit Fachwissen ausgestattet sind.
IW: Was könnte man tun, um diese Frauen zu bestärken und vor allem, diese Strukturen zu verändern? Sie haben die Organisation „medica mondiale“ gegründet, sind an viele Orte gegangen und haben etwas verändert. Aber was kann man bei uns tun und wie kann man vor allen Dingen deutlich machen, dass diese Frauen nicht nur Opfer sind, also wie kann man ihnen eine Stimme geben?
„Wir brauchen Räume, wo darüber geredet werden kann – Zeit zu sprechen!“
MH: Das ist ja etwas, was wir bei „medica mondiale“ versuchen, den Frauen eine Stimme zu geben. Durch unsere Publikationen, dadurch, dass ich in Interviews davon berichte, das tun andere Organisationen auch, ich spreche aber von unserer Arbeit vor Ort. Es gab diesen Hashtag „Aufschrei“, da sind binnen Stunden tausende von Reaktionen reingekommen. Das heißt, das Bedürfnis, sich zu artikulieren, zumal im geschützten virtuellen Raum, scheint gigantisch zu sein. Und es sind sehr viele Geschichten drin, sehr viele Aufschreie von Männern und Jungs, von Frauen und Mädchen, sowohl über das, was sie erlebt haben, aber vor allem auch darüber, wie die Gesellschaft nachher mit ihnen umgegangen ist. Und wie viel neues Leid und Traumatisierung das für sie verursacht hat. Und ich rede von der hoch entwickelten deutschen Gesellschaft.
Das heißt, wir brauchen Räume, wo darüber geredet werden kann, so wie es auch Räume gebraucht hätte für die alten deutschen Frauen, die zum Beispiel am Ende des Zweiten Weltkriegs vergewaltigt worden sind. Das war ja auch immer ein tabuisiertes Thema in der deutschen Nachkriegsgesellschaft. Als wir zum sechzigsten Jahr nach Kriegsende eine Kampagne machen wollten, mit dem Titel „Zeit zu sprechen“, weil wir ja immer wieder Zuschriften von alten Frauen gekriegt hatten, bei Vorträgen fast immer eine alte Frau aufgestanden ist, während der Diskussion und gesagt hat: “Ich habe das erlebt, wovon Frau Hauser da spricht, und ich konnte ein Leben lang nicht darüber reden. Machen sie bitte ihre Arbeit weiter, dass die bosnischen Frauen das nicht auch in fünfzig Jahren sagen müssen.“ Das war sehr, sehr berührend, es ist naturgemäß immer weniger geworden in den letzten Jahren.
Diese Kampagne „Zeit zu sprechen“ ist von niemandem unterstützt worden. Wir haben verschiedene Stiftungen in Deutschland angefragt, ob sie uns dafür finanziell unterstützen wollen, von niemandem haben wir Unterstützung bekommen. Das „Haus der Geschichte“ hat die Ausstellung „Flucht und Vertreibung“ gemacht, und das Thema sollte da nicht vorkommen. Ich habe einen richtigen Kampf mit dem Kurator damals gehabt, dass dieses Thema unbedingt vorkommen muss. Wir haben dann einen kleinen Aufruf gestartet, im Raum Bonn, Köln, und es gab etliche Zuschriften, von alten deutschen überlebenden Frauen, die dem Bonner Generalanzeiger, dem Kölner Stadtanzeiger, ihre Geschichte geschickt haben und gesagt haben: “Wir sind in diese Ausstellung gegangen und haben natürlich gehofft, dass unser Geschichte da vorkommt. Und es war sehr schmerzhaft zu erleben, dass wir nicht vorkommen.“ Der Kurator wollte mich abspeisen mit dem Argument: „Wir wollten die Frauen nicht re-traumatisieren.“
IW: Das war das „Haus der Geschichte“ in Bonn?
MH: Ja. „Wir wollten die Frauen nicht re-traumatisieren.“ In der Diskussion danach hab’ ich dann auch verstanden: Es gab eigentlich außer uns niemanden, der wirklich wollte, dass die Frauen vorkommen. Es gab eine sehr rührende Frau im Frauenverband im Bund der Vertriebenen, die die Frauensektion dort geleitet hat, Sybille Dreher, das kann ich ja ruhig mal sagen, der war es wichtig, dass die Frauen, die sprechen können, nicht erneut instrumentalisiert werden. Ihrem Verein hingegen, der hat natürlich auch da seine Interessen gehabt, das ist ganz klar. Der Kurator und eher links gerichtete Kreise hatten wiederrum große Sorge vor Revanchismus, wenn man darüber berichtet.
IW: Aber das „Haus der Geschichte“ in Bonn gilt ja nicht unbedingt als „links gerichtet“.
MH: Ich habe das aber auch immer wieder von links gerichteten so mitbekommen, dass das die große Sorge war. Auf jeden Fall hat der Kurator sich nicht mit dem Thema beschäftigen wollen. Wir haben dann sehr dafür gekämpft und in der ständigen Ausstellung in Berlin gibt’s jetzt so einen Kasten, wo wir ein Tagebuch einer überlebenden Frau in Sütterlinschrift zur Verfügung gestellt haben, die darin schreibt, was ihr in den Maitagen ´45 geschehen ist.
Aber wie wird auch über die Gewalt gesprochen, die Wehrmacht und SS ausgeübt haben? In Bosnien hab’ ich sehr viel über Gewalt und sexualisierte Gewalt gegenüber Partisaninnen gehört. Wie wird dieses Thema überhaupt benannt? In Forscherinnen-Kreisen mehr und mehr, das weiß ich. Es gibt da erfreuliche Energien, aber das ist ja noch lange nicht Mainstream. Ich war kürzlich in München bei einer Veranstaltung, da hat dann tatsächlich ein sehr betagter Herr gemeint, dass man bei dem Thema die Wehrmacht nicht mit reinziehen soll.
IW: Ausgerechnet.
MH: Die Antwort, die er bekommen hat, war natürlich klar. Es gibt also immer noch dieses Denken und daher viele Gründe, jegliche Initiative, die das Vergessen bekämpfen will, zu unterstützen. Es kommen bei dem Thema sexualisierte Gewalt verschiedene Dinge zusammen, die bis heute gesellschaftlich nicht opportun sind, weil wir bis heute hoch patriarchale Geschlechterverhältnisse auch in einem Land wie Deutschland haben. Es hat sich viel getan. Wir haben eine Bundeskanzlerin, wir haben eine Verteidigungsministerin, wir haben endlich eine Reform vom Paragraphen 177 (Sexuelle Nötigung, Vergewaltigung), für die Aktivistinnen Jahre, Jahre, Jahre gekämpft haben, aber wir haben noch sehr viele ungelöste Probleme. Wir haben immer noch Geschlechterstereotypien, die es verhindern, dass über sexualisierte Gewalt angemessen geredet werden kann.
IW: Und wenn man darüber redet, wie instrumentalisiert wird, das Grauen für bestimmte Zwecke benutzt wird, wie kommt man denn aus dieser Falle wieder heraus? Man erlebt es gerade in der Auseinandersetzung mit der Geschichte des Nationalsozialismus, mit KZ-Verbrechen und so weiter, dass Jugendliche genervt sagen: „Ja, ich war im KZ, ja, ich war in Dachau, ja ich war am Holocaust-Mahnmal…“ Wir haben das kollektive Negativ-Gedächtnis gelernt, was ja auch ein Verweilen beim Grauen ist. Wie kann man es denn schaffen, Jugendlichen einen Anreiz zu bieten, sich positiv zu engagieren? Wie geht das, mit solchen Geschichten?
„Wir brauchen die persönliche Berührung. Mit Waffen lassen sich keine Menschenrechte und schon gar keine Frauenrechte herstellen.“
MH: Wir haben eine sehr, sehr große Chance 2015 erhalten. Als die Flüchtlinge zu uns gekommen sind, war das eine große Chance für die Bevölkerung in Deutschland. Ob jetzt „Bio-Deutsche“ oder schon länger zugewanderte, sei mal dahingestellt. Ich habe die Bilder im Kopf vom Münchner Bahnhof, als Jugendliche geklatscht haben und die Menschen nach der traumatischen Balkanroute und traumatischen Dingen, die sie vorher erlebt haben, wie sie willkommen geheißen wurden. Ich bin mir sehr sicher, dass viele dieser jungen Menschen die Fluchtgeschichten ihrer Eltern im Kopf hatten, von ihren Großeltern, die sie gehört haben, was es hieß, alles stehen und liegen zu lassen und auf die Flucht zu gehen. Ich denke, da konnten sehr viele anknüpfen.
Diese Berührung brauchen wir, wir brauchen die persönliche Berührung. Es gibt ja kaum eine Familie in Deutschland, die nicht irgendetwas an Geschichten vom Ersten oder Zweiten Weltkrieg als Narrativ präsent hat. Und auch Verbrechen gegen Frauen, man weiß es eigentlich, wem es in der Familie passiert ist, das Wissen ist ja oft da. Wir müssten eine gesellschaftliche Stimmung schaffen, in der darüber adäquat mit großem Respekt geredet und der Schmerz betrachtet werden kann.
Wir haben uns in unserer politischen Menschenrechtsarbeit in Richtung Berlin immer wieder gefragt, warum es 25 Jahre lang eine solche Ignoranz gab, uns näher anzuhören beim Thema sexualisierte Kriegsgewalt. Irgendwann ist mir klar geworden, dass da alte Politiker und Politikerinnen, aber in erster Linie natürlich Männer sitzen, die mit dem Thema was zu tun haben könnten. Wir kennen die Geschichte von Gerhard Schröder, wir kennen die Geschichte von Horst Köhler, wobei mich immer gewundert hat, dass diese Geschichte nicht noch mehr transportiert wurde. Das sind alles Fluchtgeschichten und wir können mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass diese Jungen damals was von Vergewaltigungen mitgekriegt haben. Entweder in der eigenen Familie oder von Nachbarinnen und so weiter. Das ist als Schmerz in den Familien tief vergraben worden. Und auch die Jungs haben das tief vergraben müssen. Und später dazu, als erwachsene Männer, wieder eine Verbindung herstellen zu müssen, scheint den allermeisten nicht gelungen zu sein.
Vielleicht braucht es dazu wirklich eine neue Politiker-, Politikerinnen-Generation, die dieses Thema anders angehen kann. Wir arbeiten mit einer UN-Resolution aus dem Jahre 2000. Das ist die Resolution 1325 (vom 31. Oktober 2000), die ist für unsere politische Arbeit in Deutschland und weltweit sehr, sehr wichtig. Die hat Kofi Annan damals unter Druck von Aktivistinnen weltweit erstellen lassen. In der steht alles niedergeschrieben, was zum Schutz und zur Sicherheit für Frauen und Mädchen in Kriegsgebieten und Nachkriegsgebieten wichtig ist. Es geht um Schutz, es geht um Partizipation und Prävention. Alle drei Bereiche sind nach wie vor äußerst mangelhaft und die Resolution wird nicht wirklich umgesetzt. Deutschland hat sich über zwölf Jahre lang geweigert, einen eigenen nationalen Aktionsplan zu erstellen. Das wäre Pflicht gewesen, wenn man die Resolution mit ratifiziert hat. Erst im Jahre 2012 gab es den ersten Aktionsplan, den wir sehr begrüßt haben. Leider ist er immer noch nicht mit einem eigenen Budget ausgestattet, es gibt kaum personelle Ressourcen in Berlin, und so weiter.
Wir sind froh, dass dies nun endlich ernst genommen wird und weitergeht, aber als Frauenorganisation müssen wir immer hinterher sein. Wir haben durchaus Politikerinnen und wenige Politiker, die das mittlerweile unterstützen. Die sind alle aus der jüngeren Generation, die verstehen, warum es so wichtig ist, diese Themen in die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik mit einzubringen. Das ist etwas, das ich seit 25 Jahren in Berlin deutlich machen will: Dass die eigene Politik massive Auswirkungen auf Interventionen vor Ort hat, und zum Beispiel die rein militärisch ausgerichtete Intervention in Afghanistan über fünfzehn Jahre soviel neue Traumatisierungen vor Ort bewirkt hat, soviel neuen Schaden angerichtet hat und die Frauen letztendlich auch im Stich gelassen worden sind. Dieses militärische Primat war der völlig falsche Weg. Wir kamen aber nicht zu Gehör mit unseren Bedenken und unserem Wissen, das wir schon seit 1993 gesammelt haben. Mit Waffen lassen sich keine Menschenrechte und schon gar keine Frauenrechte herstellen.
IW: Ich komme nochmal kurz zurück auf Ihren Punkt, wie kann man etwas bewegen, dass man Räume schaffen sollte, wo man offen und respektvoll miteinander reden kann, sich die Geschichten erzählen kann. Ich habe es oft so erlebt, dass es an diesen Punkt, wenn es an den Schmerz kommt, also eigentlich kommt es selten da hin, weil der Raum nicht so geschützt ist, dass es in den Gesprächen so weit kommt, aber es kann auch dazu führen – gerade beim Thema Nationalsozialismus –, dass dann, wenn dieser Schmerz so groß war, es auch zu einer Abwendung führt. Wie kommt man aus diesem Schmerz dann wieder raus? Einerseits mit dem Blick auf die Frauen oder die Überlebenden die ihn selbst haben, andererseits diejenigen, die offen genug sind, sich dem zu stellen und ihn zu teilen? Es geht um das Teilen, glaube ich. Wie kriegt man Menschen dazu, dann daraus gemeinsam etwas Positives zu machen? Meine Sorge ist dieses Verweilen bei dem Schmerz. Man muss ja irgendwie wieder da rauskommen.
„Wir sind die Krise! Nicht die Flüchtlinge!“
MH: Das Leben kann nicht gleich weitergehen, wenn man so eine Geschichte gehört hat, und sie einem nahekommt. Und Frauen kommen solche Geschichten von sexualisierter Gewalt schnell sehr nahe, es gibt kaum eine Frau, die nicht in irgendeiner Form einen Übergriff erlebt hat. Dann passiert etwas mit uns, da müssen wir dann eine Möglichkeit haben, damit gut umgehen zu können. Aber dann etwas in mein weiteres Leben zu transferieren, damit das auch einen Sinn hat, was ich da gehört habe, dazu muss ich mich danach engagieren. In welcher Weise ich das auch tue. Wir haben sehr, sehr viele Möglichkeiten. Das kann von mehr Aufmerksamkeit in der Schule, wenn ich zum Beispiel eine Mutter bin, bis zu wirklich eigenen Projekten gehen. Da mittlerweile fast überall geflüchtete Menschen leben, habe ich da viele ehrenamtliche Möglichkeiten, mich zu engagieren. Das dann auch wieder in mein Leben mit reinzuholen und es mit der deutschen Geschichte zu verbinden.
Ich finde, das ist eine sehr, sehr große Chance, und wehre mich gegen den Begriff „Flüchtlingskrise“! Wir sind die Krise! Nicht die Flüchtlinge. Die Flüchtlinge haben das getan, was auch eine deutsche Mutter und ein deutscher Vater tun würde, nämlich im Libanon, wo die UN kein Geld mehr hat – weil die westlichen Industrieländer nicht mehr zahlen –, und ich sehe, dass meine Kinder am Verhungern sind und meine Familie überhaupt keine Lebensperspektive mehr hat: Dann nehme ich doch meine Kinder und ziehe los, dahin, wo ich denke, dass es eine Perspektive gibt. Das würde jede Mutter und jeder Vater auch tun. Sie haben also etwas völlig Menschliches gemacht. Und wir haben dann angefangen, Zäune und Regularien und Gesetze zu bauen, die Gesetze haben nicht ausgereicht, und jetzt bauen wir Zäune, zwei Schichten, drei Schichten, und immer noch kommen die Menschen oben drüber, also das heißt, mit unserer Politik haben wir so viel Schaden in der Welt angerichtet.
Wir lassen internationale Saatgut-Konzerne in Afrika ganze Regionen aufkaufen, vernichten damit die Existenz von sehr, sehr vielen Kleinbauern und wundern uns dann, dass die kommen und sagen: „Hallo, wir wollen auch überleben!“ Eigentlich können wir ja erstaunt sein, dass die zerstörerischen Konsequenzen unseres Handelns der letzten 150 Jahre, dass wir da nicht dafür büßen müssen. Jetzt hat es angefangen, dass geflüchtete Menschen auch den Weg nach Europa gefunden haben, ein kleiner Bruchteil. Wir sollten uns auch nicht so haben und meinen, die Millionen, die nach Deutschland gekommen wären, die sind der Untergang. Wenn wir uns anschauen, was afrikanische Länder an Last durch ganz andere Zahlen zu beherbergen haben, dann sollten wir uns eigentlich demütig verhalten und vor allem sollten wir eine ganz andere Politik machen. Eine, die Fluchtursachen bekämpft, das ist das, was mich extrem ärgert, dass Makulatur-Politik gemacht wird, und nicht die Fluchtursachen analysiert und bekämpft werden. Denn dann würde man keine Rüstungsexporte mehr machen können. Dann würde man eine ganz andere Klimapolitik gestalten müssen, eine ganz andere Wirtschaftspolitik und so weiter. Es würde sich etwas massiv verändern. Wenn ich bei Vorträgen mit Leuten rede, alle wollen, dass sich etwas verändert, alle wissen, so kann es nicht weitergehen. Wir haben einen Reichtum auf Kosten der Armut anderer. Dass dann irgendwann ein Bruchteil von denen, die keine Lebensexistenz für sich mehr vor Ort sehen, dass die dann kommen, das ist eigentlich ziemlich klar. Wie verhalten wir uns jetzt hier? Die Worte von Frau Merkel, die waren ja sehr, sehr richtig, wir hätten es schaffen können, wenn nicht wieder so viele Fehler gemacht worden wären.
Es ist nicht strukturell unterfüttert worden, wo da mit offenem Herzen gesagt wurde: „Wir schaffen das!“ Da hätte man danach natürlich die Fachkompetenz und das Fachwissen zusammen holen müssen und ganz andere strukturelle Unterfütterung dessen schaffen müssen, dass die Menschen hier wirklich Wohnungen haben, Berufe lernen können, angenommen werden, integriert werden. Das werden sie nicht, wenn sie in abgewrackten Baumärkten monatelang leben müssen, ohne zu wissen, wann überhaupt die Anhörung kommt. Und Frauen erleben wieder neue Gewalt. Das ist ein weiteres Armutszeugnis. Dass sie in den Flüchtlingslagern Gewalt erleben, von Mitgeflohenen, von Security-Leuten, vom deutschen Personal. Es ist ziemlich unerträglich, was sich abspielt, aber für viele spielt sich eben nichts ab, weil die Flüchtlingslager weit draußen sind und man eigentlich weiterleben kann wie vorher.
IW: Man hat gesagt: „Wir schaffen das!“ und danach die Situation immer mehr verschärft.
MH: Wenn wir diese Realitäten, diese aktuellen Realitäten, und damit meine ich sowohl, was deutsche Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik vor Ort anrichtet, als auch, was wir jetzt, seit 2015 an Erfahrungen haben, wie man hier zu Lande mit geflüchteten Menschen umgeht, wenn man das alles verknüpft mit den Erfahrungen aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, dann kommen wir natürlich um den Schmerz nicht herum. Um den kommen wir sowieso nicht herum. Der ist ja da, der Schmerz ist in den Menschen. Und diesen Schmerz anzuschauen ist viel ungefährlicher für eine Gesellschaft, als ihn zu verdrängen und ihn nicht anzuschauen. Dafür müssen wir aber Räume schaffen, mit adäquaten Strukturen. Das wäre wieder eine Aufgabe. Wir haben es aber noch nicht einmal geschafft, obwohl wir eine der reichsten Nationen global sind, genügend Beratungsstellen für unsere Kinder und Jugendlichen zur Verfügung zu stellen, die langsam aber sicher mehr und mehr abdrehen. Dieses Schulsystem ist so zerstörerisch für viele, da kommen immer wieder welche gut durch, keine Frage, aber für viele ist es so zerstörerisch, dass sie immer kränker werden. Ich weiß, dass Kinder monatelang auf einen Beratungstermin warten. Was machen wir mit unseren Kindern und Jugendlichen? Was für eine Politik gestalten wir? Dass wir das nicht als unsere oberste Priorität sehen. Herr Schäuble will die schwarze Null. Das ist doch ein Verbrechen an all denen, die hier in diesem Land Gewalt erleben und keine adäquate Betreuung kriegen.
IW: Ich komme nochmal auf die Geschichte der Einzelnen zurück. Wir haben eingangs darüber gesprochen, da fielen Ihnen schon zwei, drei Geschichten ein, als wir über das Thema Widerstand gesprochen haben. Wenn man jetzt all diese Negativa aufzählt, der Umgang mit den Kindern, der Umgang mit den Frauen, mit dem Klima, alles was wir angesprochen haben, was kann das Erzählen dieser Geschichten eigentlich beitragen? Fallen Ihnen Geschichten ein, von denen Sie sagen würden, das wäre wichtig, dass diese Geschichte werden, tragt sie in Schulen, tragt sie in Räume, wo man sich respektvoll damit auseinandersetzt?
„Gerade bei Frauen sehe ich so viel Mut.“
Die Geschichte von Shirin, einer jungen Afghanin
MH: Also es sind Geschichten, die Schmerz und Wut in gleicher Weiße verkörpern. Der Schmerz ist immer da, weil so viel Gewalt geschieht. Gerade aber bei Frauen sehe ich so viel Mut. Der könnte ja wieder andere ermutigen, in ihren Lebenssituationen sich anders zu verhalten oder sich auf den Weg zu machen. Und sich auf den Weg zu machen, heißt immer, das Innen anzuschauen, wenn wir immer nur im Außen bleiben, kommen wir nicht wirklich vorwärts. Aber dieses Innen anschauen, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, das ist ja mit etwas vom Schwierigsten und Schmerzhaftesten, aber auch vom Lohnendsten. Wie so eine Forscherin sich auf den Weg zu machen, was sind denn die ganzen Störungen in mir? Warum hab’ ich solche Einschränkungen? Womit hat das biographisch zu tun? Sich das genauer anzuschauen. Aber es braucht eben Mut.
Also ich kann die Geschichte von Shirin erzählen, einer jungen afghanischen Frau, die ziemlich dramatisch ist, und die mit sehr viel Schmerz zu tun hat, aber eben auch mit ihrer Kraft, ihrem Mut, und dass sie trotz all dem, was sie erlebt hat, ihren Lebensweg gut gehen wird. Sie ist als Fünfzehnjährige in Afghanistan von ihren Eltern zwangsverheiratet worden, mit einem sehr viel älteren Mann. Musste dann schnell Kinder kriegen, hat einen Jungen und ein Mädchen bekommen, wollte aber weiter zur Schule gehen. Sie war sehr wissbegierig, sehr klug, und da begannen die Probleme insofern, als ihr Mann wahrgenommen hat, dass er eine Person an seiner Seite hat, die er nicht nur nach Lust und Laune vergewaltigen und über sie verfügen kann, sondern dass sie Widerstand leistet und sagt: „Ich will wieder zur Schule gehen!“, „Ich möchte wieder etwas lernen!“ Da hat er angefangen sie zu schlagen und ist sehr gewalttätig geworden. Als sie wieder einmal Widerworte gegeben hat, hat es ihm gereicht, und er hat sie mit Benzin übergossen und sie angezündet. Sie hat massivste Verletzungen davongetragen, und war über Wochen dem Tod näher als dem Leben.
Sie ist dann in eine Verbrennungsklinik gekommen, wo auch unsere Partnerorganisation „medica Afghanistan“ tätig ist, eben gezielt dort, weil diese Problematik ebenso massiv in Afghanistan ist. Es sind Psychologinnen, Sozialarbeiterinnen, Juristinnen in dieser Klinik tätig. Dort hat Shirin Unterstützung von „medica“-Beraterinnen bekommen und ist ins Leben zurückgekehrt. Sie hat weiter unsägliche psychische Gewalt erlebt, in dem die Schwiegereltern ihr die Schuld für das gaben, was passiert ist. Der Mann ist auf Betreiben der Juristinnen inhaftiert worden. Er ist allerdings nicht lange in Haft geblieben, weil er von seiner Familie freigekauft werden konnte. Diese Schwiegerfamilie hat die Kinder in die Verbrennungsklinik gebracht, schon in den ersten Tagen, nachdem Shirin dort aufgenommen worden ist, und man kann sich vorstellen, wie sie ausgesehen hat – ziemlich schrecklich. Die Kinder sind schreiend aus der Klinik rausgerannt. Das hatten die Schwiegereltern bezweckt, die den Kindern gesagt haben: „Schaut, so sieht eure Mutter aus, sie ist eine ganz schlechte, böse Frau!“ Und die Kinder haben sich für immer von ihr abgewandt. Das ist ihre große Pein gewesen, neben dem körperlichen Schmerz, die Demütigung die sie erlebt hat, aber auch das Wissen, dass sie ihre Kinder nicht zurückbekommt.
Sie ist dann zu ihren Eltern zurückgezogen, die sie wieder aufgenommen haben, hat eine Ausbildung machen können, hat bei „Medica Afghanistan“ eine Position als Lehrerin für Analphabeten bekommen und konnte ihr eigenes Geld verdienen, ihre Würde wiedererlangen und Selbstvertrauen entwickeln. Sie hat mit Hilfe einer Juristin versucht, die Kinder zurückzubekommen. Das ist nicht möglich gewesen. Und irgendwann haben sie ihr auch deutlich gemacht, dass das auf absehbare Zeit nicht der Fall sein wird, dass sie ihre Kinder zurückkriegt. Das war der Moment für sie, an dem sie sagte: „Dann muss ich hier weg!“ Sie hat weiter Diskriminierungen erlebt, ihre Eltern haben sie dazu gedrängt, einen Mann zu heiraten, damit sie nicht weiter bei ihnen zu Hause ist. Die Auswahl war ziemlich schlimm, weil sie ja nun eine verbrannte Frau war.
Ich habe sie kennengelernt, als wir einen Workshop in Kabul gemacht haben und die Mitarbeiterinnen von allen drei „Medica“-Standorten für diesen Workshop zusammengekommen sind. Sie hat von Anfang an gesagt, dass sie da unbedingt hinwill, weil sie mich kennenlernen möchte. Wir haben eine sehr berührende Begegnung gehabt. Sie hat nach wie vor ein ziemlich verbranntes Gesicht, trotz mehrerer Operationen, die aber mehr den Vitalfunktionen dienten als kosmetisch gewesen wären, und trotzdem sieht man, was für eine schöne Frau sie vorher gewesen sein muss, sie hat wahnsinnig lebendige, leuchtende Augen. Über diese Augen haben wir gesprochen. Über unsere Augen. Sie hat mich sehr, sehr beeindruckt und sehr berührt.
Während unseres Workshops, an einem Tag, waren auch die männlichen Mitarbeiter dabei, wir haben Fahrer, einen IT-Spezialisten, usw., die sonst bei diesem Workshop nicht dabei sind, aber an dem einen Tag konnten sie dabei sein. An dem Tag wollte Shirin unbedingt ein Gedicht vorlesen, was sie selber geschrieben hat. Es war sehr beeindruckend. Sie hat mit kräftiger Stimme über ihr Leid geklagt, und ich war sehr beeindruckt davon, wie die Männer geweint haben. Also es war berührend. Da ist nochmal viel in der Organisation passiert, zu sehen, was für eine Stärke diese junge Frau hat. Sie war knapp über zwanzig und hat schon alles erlebt, was man im Leben erleben kann. Sie ist dann zurück an ihren Ort.
Das nächste, was ich von ihr hörte, war, dass sie in Deutschland angekommen ist. Sie hat, nachdem sie wusste, dass sie endgültig ihre Kinder verloren hat, gesagt: „Dann muss ich nach Deutschland. Ich kann hier nicht länger bleiben. Ich will auch nicht erneut von meinen Eltern zwangsverheiratet werden. Ich kann mich kaum wehren, denn wer bin ich schon?!“ Sie hat sich mit einer anderen Frau auf den mühsamen, gefährlichen, langwierigen, verlustreichen Weg nach Deutschland begeben und hat es tatsächlich geschafft, hierher zu kommen. Jetzt lebt sie in einer norddeutschen Stadt, lernt Deutsch, und das letzte Mal, als wir uns getroffen haben, hat sie mir gesagt: „Jetzt will ich Sozialarbeiterin werden, ich hoffe, ich kann hier die Ausbildung machen und dann auch mit geflüchteten Frauen hier arbeiten, denen Mut geben. Ich möchte etwas zurückgeben von dem, was mir „Medica Afghanistan“ gegeben hat, und anderen Menschen, die mich auf meinem Weg unterstürzt haben. Das will ich zurückgeben.“
IW: Was für eine Geschichte!
MH: Eine ziemlich verrückte Geschichte, die ich medial einfach nicht erzähle, weil man mir sonst auf die Pelle rückt, weil man wissen will: „Wo ist sie? Wer ist das?“ Und ich habe ganz große Sorge, wir wissen, wie die Medien damit umgehen, und deswegen ist das hier ein Rahmen, wo ich darüber reden kann, aber ich weiß jetzt schon, da werden dann Fragen kommen, wenn ich es in den Medien selbst berichte, will man mit ihr reden, das ist aber absolut unzulässig. Außer sie ist eines Tages soweit, dass sie selbst sagt: „Dann mach’ ich das“ oder „Ich schreibe darüber“.
IW: Wie ist sie dann hierher gekommen? Über welchen Weg?
MH: Über die Schlepperwege, die Balkanroute. Als ich sie gefragt habe: „Was hast Du unterwegs erlebt?“, hat sie gesagt: „Das erzähl ich Dir dann mal in fünf Jahren.“ Unsagbar. Frauen zahlen immer mit ihrem Körper, für jedes neue Teilstück. Und ich rede nicht nur von Mitgeflüchteten, ich rede von serbischen Beamten, von kroatischen Beamten, von ungarischen Beamten, von allen, die da so auf dem Weg sind. Polizei, Behörden, Sicherheitsleute, Schlepper.
IW: Was glauben Sie, woher hat sie die Kräfte genommen?
MH: Eine sehr, sehr gute Frage.
IW: Sie war ja im Grunde ein Kind!
MH: Sie war ein Kind, ist sie ja jetzt immer noch. 23 oder sowas, 23. Und mit dem Verlust der beiden Kinder!
IW: Und die Eltern?!
MH: Die Eltern, die haben sie verkauft, die haben sie zwangsverheiratet, beim ersten Mal, die Eltern hat sie hinter sich gelassen.
IW: Woher kriegt jemand diese Kräfte?
MH: Mich hat schon sehr beeindruckt, wie sie dieses Gedicht gelesen hat, und diese Augen, dieses Strahlen in ihrem Gesicht trotz allem, was sie erlebt hat. Sie hat es ja auch geschafft, mich zu finden, sie hat mich sehr berührt.
IW: Das war dann auch für Sie eine Lücke, oder?
MH: Da hatte ich auch eine Lücke, ja, ja, das sind ja Monate dazwischen. Wir haben ja auch nicht ständig Kontakt gehabt. Aber als ich dann hörte, dass sie in Frankfurt im Auffanglager gelandet ist, da dachte ich, wie lange habe ich jetzt nichts von ihr gehört?
„Eine Geschichte zum Thema Straflosigkeit im Kosovo“
MH: Soll ich Ihnen noch eine Geschichte erzählen? Wo es mehr um das Thema Straflosigkeit geht. Eine junge Frau im Kosovo, die ihren Bruder im Krankenhaus in Pristina besuchen wollte, das war im Jahr ´98, also als die serbische Kooptation in vollem Gange war. Das Krankenhaus war schon von Serben besetzt und sie ist eben dort von einem serbischen Kommandanten vergewaltigt worden. Sie hat es irgendwie geschafft, zu fliehen und ist zurück in ihr Heimatdorf, hat dort sehr traumatisiert gelebt, und hat über einen Anschlag an der Apotheke von „Medica Kosova“ erfahren, ist dann zu „Medica“ gekommen und hat therapeutische Unterstützung bekommen.
Irgendwann kam ein Anruf aus Den Haag, dass, weil der Täter in der Hierarchie relativ weit oben war, sie eine wichtige Kronzeugin sei, und sie sich für ein Interview bereitmachen soll. Es ist dann auch jemand aus Den Haag zu ihr gekommen, der weiße Jeep stand natürlich vor ihrem Haus, und das ganze Dorf hat sowieso schon vermutet, dass da was Spezielles in Pristina mit ihr passiert ist. Das Dorf hat natürlich selbst auch Krieg erlebt, aber irgendwie wusste man, dass ihr da in Pristina was besonders Schlimmes passiert ist.
Sie hat dann ausgesagt, über ihre ganze Geschichte, weil der Täter höherrangig war, war man an ihr interessiert. Und deswegen dieser Anruf aus Den Haag, sie soll sich bereitmachen, sie werde mit einer Gruppe von anderen Frauen nach Den Haag fliegen, um dort ihre Aussage im Prozess zu machen. Da war sie natürlich sehr aufgeregt, hat aber gedacht, das ist die Chance, aus dem Kosovo wegzukommen. Man hat ihr angeboten, dass sie eine neue Identität bekommt. Sie hat ihrer Mutter gesagt: „Ich werde gehen, für immer,“ und hat sich auf die Abreise vorbereitet. Dann hat sie monatelang nichts mehr aus Den Haag gehört, monatelang. Irgendwann war es dann doch soweit, es war mindestens ein halbes Jahr später, und sie ist in einer Gruppe von mehreren Zeuginnen im Flieger von Pristina nach Den Haag gebracht worden, und in diesem Flugzeug waren auch Täter drin. Das ist etwas, das ich auch in Bosnien erlebt habe, dass bosnische Zeuginnen mit ihren Tätern im gleichen Flugzeug nach Den Haag fliegen mussten.
Sie hat dann eine lange Wartezeit in Den Haag gehabt. Mittlerweile hatte sie ein kleines Kind, sie hat sich in ihrem Heimatort mit einem Mann verheiratet, von dem sie dachte, dass er sie einigermaßen gut behandelt, weil sie sehr viele Diskriminierungen in dem Ort erlebte. Nachdem klar war, dass sie wahrscheinlich in Den Haag aussagen wird und dass sie in Pristina vergewaltigt worden ist, hat man zum Beispiel „serbische Hure“ auf ihre Hauswand gesprüht. Sie konnte eigentlich kaum aus dem Haus, ohne dass man ihr nicht irgendetwas nachgerufen hat. Zum Schutz hat sie diesen Mann geheiratet und ein Kind mit ihm bekommen. Es war aber für sie klar, dass sie gehen wird und mit ihrem Mann nichts weiter zu tun haben will. Das war keine Beziehung, die mehr gewesen ist, als Schutz.
Nun war sie also mit dem kleinen Kind in Den Haag und nur auf unser Intervenieren hin hat man ihr eine ordentliche kleine Wohnung zur Verfügung gestellt, weil sich die Monate schon wieder hinzogen und sie mit ihrem Kind in einer unmöglichen Sammelunterkunft war. Sie war schließlich eine der wichtigsten Zeuginnen, ist aber in eine immer schwerere Depression gefallen. Nach vielen Monaten hat sie dann beim Prozess ausgesagt, bloß um zu erfahren, dass ihre Aussage für den Prozess nicht genommen wird.
Das ist ein weiteres Thema, dass Frauen eigentlich überhaupt keine Gerechtigkeit erfahren, weil das Thema der sexualisierten Gewalt oft aus Prozessen herausgenommen wird, aus verschiedensten Gründen. Zum Beispiel wird ein Deal zwischen Gericht und Täter gemacht, dass man bestimmte Straftatbestände herausnimmt, und er dafür dann anders akzeptiert. Und interessanterweise haben mehrere bosnische und serbische Täter, von denen weiß ich es, vielleicht auch andere, darauf gedrungen, dass der Straftatbestand nicht in der Anklage erscheint. Nachdem sie jahrelang Frauen vergewaltigt haben, Männer und Frauen weiterverkauft haben, organisiert haben, dass ganze Wohnungen und Lager voll von Frauen waren, die straflos von ihren Soldaten vergewaltigt werden konnten, war das dann doch danach in ihrem Alltagsleben, zurück aus dem Krieg, anscheinend der größere Makel, wegen sexualisierter Gewalt angeklagt zu werden, als für all das andere, was sie verbrochen haben. Auf jeden Fall hat sie dann auch wieder nur auf Druck hin eine neue Identität bekommen und lebt heute in einem skandinavischen Land.
Ich habe schon sehr lange nichts mehr von ihr gehört, wir haben eine sehr, sehr gute Beziehung miteinander gehabt, uns in den früheren Jahren oft getroffen und ich denke, dass für sie „Medica“ damals eine Möglichkeit war, zu überleben. Nach diesen ganzen Erfahrungen mit diesen Prozessen hat sie mir irgendwann einen Abschiedsbrief geschrieben und meinte: „Ich will mit diesem früheren Leben nichts mehr zu tun haben und will hier in Skandinavien neu beginnen und danke Dir für alles, ich fang’ jetzt was Neues an.“
IW: Diese Erfahrung, die Sie am Gerichtshof gemacht hat, ich meine, es gibt doch Zeugenschutzprogramme, oder nicht? Sie haben doch einen Opferfonds eingerichtet, ist das noch nicht institutionalisiert? Es sollte doch auch von der UN jemand zur Verfügung stehen?
„Für die Kriegsverbrecherprozesse stehen nicht genügend Ressourcen zur Verfügung.“
MH: Da ist einiges passiert, wir haben uns ja auch sehr eingemischt, für das neue Statut des ICC, des ständigen Gerichtshofes. Wovon ich gerade gesprochen habe, war noch das Adhoc-Tribunal zu Ex-Jugoslawien. Man hat sicherlich viel daraus gelernt und das neue Statut berücksichtigt auch Straftatbestände, die vorher nicht berücksichtigt wurden, es ist die Rede von Nebenklage und so weiter, den Rechten der Zeuginnen. Aber sehr oft wurde der Straftatbestand von sexualisierter Gewalt aus den Anklageschriften herausgenommen. Das war zum Beispiel auch Carla Del Ponte, die das forciert hat, weil ich dann viel längere Prozesse habe. Und das Interesse war in Den Haag, die Prozesse zum Abschluss zu bringen, weil klar war, dass die Jahreszahl sehr begrenzt war, wo man agieren konnte.
Ein neueres Beispiel ist am OLG Stuttgart der Prozess gegen Ignace Murwanashyaka, der kongolesische FDLR-Täter, der von Deutschland aus per Handy militärische Operationen seiner Rebellen vor Ort gesteuert hat. Bei diesem Prozess hat eine Opferzeugin nach der anderen ihre Aussage zurückgezogen, weil sie nicht gesehen haben, dass ihnen da Gerechtigkeit widerfährt. Man muss natürlich bei solchen Prozessen Settings schaffen, die adäquat sind für die Frauen. Wo sie nicht re-traumatisiert werden, wo sie während des ganzen Prozesses eine therapeutische Unterstützung haben, eine gute Vorbereitung bekommen und wo sie vor allem eine Aufklärung bekommen darüber, dass sie eine Nebenklage führen könnten.
Das hat keine einzige kongolesische Opferzeugin gewusst. Also da ist etwas schiefgegangen, was eigentlich voraussehbar war. Weil man bestimmte Dinge nicht berücksichtigt hat, man kann nicht nur sagen, ich peitsche jetzt so einen Prozess durch – was schwer genug, das ist mir klar, juristisch ein Drahtseilakt –, dafür müssen genügend Ressourcen zur Verfügung stehen. Ich denke, das ist jetzt in Deutschland ein großes Problem für die Justiz überhaupt, auch hier ist die Frage, was hat politische Priorität. Da viel zu wenig Ressourcen vorhanden sind, um solche Prozesse gegen Kriegsverbrecher ordentlich durchzuführen, das ist ein großes Unternehmen. Da sitzen Deutsche zu Gericht, in dem Fall baden-württembergische Richter, Staatsanwälte, Personal, was keine Ahnung von der Situation vor Ort hat, die Sprache nicht spricht. Es war wahnsinnig aufwendig und es gab aufgrund von sprachlichen, von kulturellen Problemen, ständig Unterbrechungen. Wenn ich solche Prozesse mache, muss ich mir natürlich vorher überlegen, wie ich diese Probleme angehe. Das ist nicht geschehen, daher haben diese Frauen auch letztendlich keine Gerechtigkeit erfahren.
Es müsste auch eine Debatte in Deutschland in der Bevölkerung sein: „Wollen wir solche Prozesse?“ Gerade auf Grund der deutschen Geschichte. Und wenn wir sie wollen, dann müssen wir auch anständig und adäquat ausgestattet sein. Mit dem entsprechenden Know-how und den entsprechenden Settings. Gerade auch, um den traumatisierten Zeuginnen und Zeugen gerecht werden zu können.
IW: So ist das eigentlich eine Neuauflage dessen, was wir in den NS-Prozessen erlebt haben. Da gab es auch keine Zeugenbetreuung. Die hat erst Fritz Bauer im Frankfurter Ausschwitz-Prozess eingeführt. Dass überhaupt einer mal vom Flughafen abgeholt worden ist. Und dann nach dem Prozess jemand mit ihnen zusammen war, sonst wären sie allein gewesen, da wäre niemand gewesen.
MH: Ich spreche neben dem Abholen vom Flughafen natürlich auch von psychologischer Betreuung, das kann nicht sein, dass das nicht Standard ist. Es gibt viele weitere Probleme, wie die Information der Nebenklage usw., alles ungelöste Themenfelder, wenn man dem gerecht werden will, dass man solche Prozesse für die Zeuginnen und ihr Wohlbefinden und ihre Gerechtigkeit macht.
IW: Was glauben Sie, ist die Bedeutung vom Erzählen dieser Geschichten?
„Die geflüchteten Menschen, die hierher gekommen sind, die haben alle die Kraft mitgebracht.“
MH: Wie kann man berühren? Unsere Grundfrage, und aktivieren, das ist das B vom A. Es ist so eine komische Zwischenstimmung in Deutschland. 2015 wäre so viel möglich gewesen. Jetzt sind viele der Ehrenamtlichen frustriert, wegen Behördenstillstand, und, und, und. Was war da für ein Geist, 2015! Das müssten wir wiederholen können, viele sind sicher in Wartepositionen. Es sind Existenzängste bei ganz vielen da, ob berechtigt oder nicht, es sind hier Ängste, oder auch eine Verzagtheit bei Behörden.
Wo wir arbeiten, seit 25 Jahren, da ist eine ganz andere Kraft, in diesen Nachkriegsgebieten, obwohl die ja strukturell am Boden liegen, ökonomisch am Boden liegen, da ist eine andere Kraft da. Da müsste was transferiert werden können. Die geflüchteten Menschen, die hierher gekommen sind, die haben alle die Kraft mitgebracht.
IW: Da ist dann vielleicht der Punkt, wenn man mit ihnen zusammenkommt, dann passiert was, weil man diese Geschichten erzählt kriegt, danach ist etwas anders.
MH: Das definitiv, das ist mit Zeitzeugen aus dem Zweiten Weltkrieg so, mit Zeitzeugen aus welchen Kontexten auch immer, und jetzt mit Geflüchteten. Es können nicht alle in dieser Weise sprechen, aber viele wollen es, und sie könnten noch einmal ganz anders damit umgehen, wenn man etwas von ihnen wissen wollte. Sie leben ja komplett isoliert, in irgendwelchen Baumärkten. Und die Deutschen leben mit ihrer Verzagtheit auch isoliert. Also ich kann Ihre Frage nicht wirklich beantworten. Was müssen wir tun? Oder wie können wir es schaffen?
Aber das müsste getan werden, Erzählkaffees, geschützte Räume, in einer ganz anderen Weise eine Kommunikation herstellen, die beiden Seiten guttut, die für beide Seiten wichtig ist. Und aus dieser arroganten deutschen Haltung heraus zu kommen, wir geben humanitäre Hilfe. (…) Eine Achtsamkeit muss natürlich in allem drin sein, eine Achtsamkeit, was bedeutet es für beide Seiten, man muss nicht alles immer therapeutisch begleiten, aber man muss schon Leute dabeihaben, die was verstehen, die auffangen können, wobei wir auch gleichzeitig sicher sein können, dass alle extreme Schutzstrukturen aufgebaut haben. Darauf kann man auch ein Stück weit vertrauen, von beiden Seiten.
Aber dass man dann auch jemanden im Raum hat, darüber muss man schon nachdenken, dass man Menschen dabeihat, die auffangen können. Aber ich hab’ auch die Erfahrung gemacht, wenn man gute Settings schafft, wo Schmerz gezeigt und rausgelassen werden kann, ist das schon etwas ganz Besonders. Wenn jemand dann in Schock gerät und zusammenbricht, dann braucht man professionelle Hilfe, keine Frage, das ist aber nicht die Regel. Die Regel ist eher, dass dies sehr entlastend ist. Dass ein Stück des Schmerzes gezeigt werden kann und ich sehe in deinen Augen, dass du meinen Schmerz spürst. Das ist schon sehr, sehr viel wert. Wenn es nicht Extremsituationen sind.
IW: Danke, ich hoffe und wünsche, wir werden dieses Gespräch fortsetzen.
Film und Kamera: Jakob Gatzka (BUXUS FILMS)
Transkription: Antonia Samm